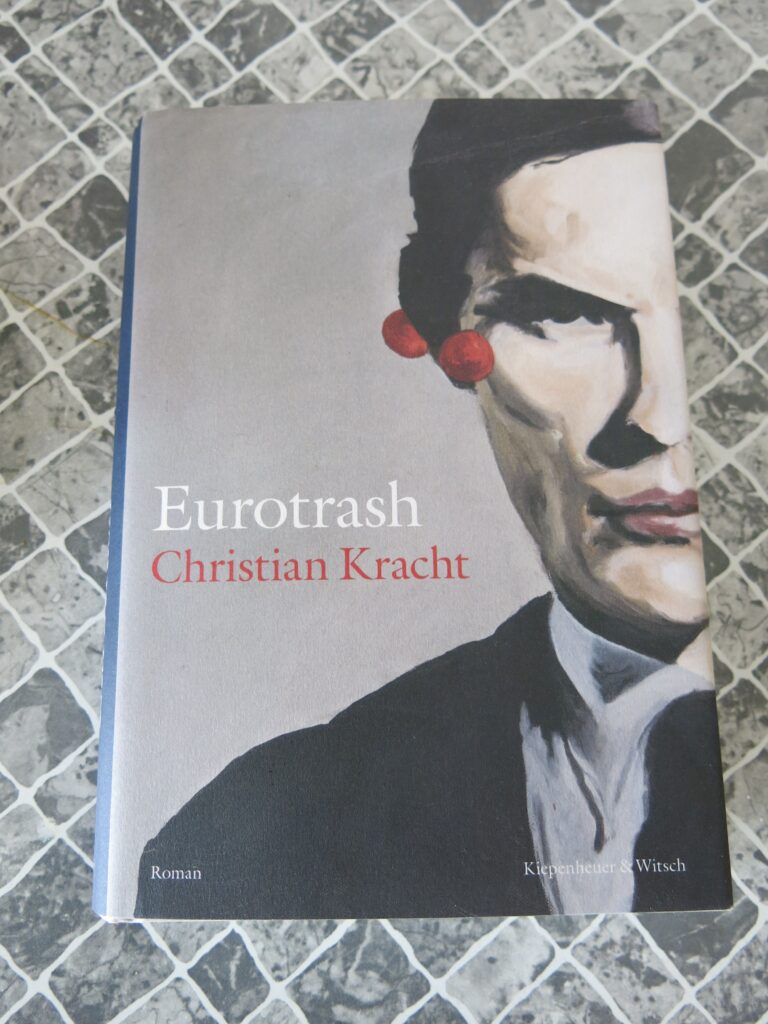
Ich betrete die hiesige Buchhandlung, schaue mich nach lokaler Literatur um, aber dann fällt mein Blick auf Krachts „Eurotrash“. Ein Bekannter hat mir das Buch vor Wochen empfohlen, in Erinnerungen schwelgend, wie er damals mit Christian um die Häuser gezogen war. Ich konnte mir die beiden gut zusammen vorstellen. Der Hang fürs leicht Anrüchige hinter der perfekten Fassade, musste sie verbunden haben.
Also kaufe ich das Buch, denn ich spüre, wie eine leichte Depression in mir anschwillt. Meine Seele hat sich irgendwo gestossen, vielleicht war’s gar ein harter Aufprall, den ich in meiner Geschäftigkeit einfach ignoriert habe. Nun aber meldet sich die Flüssigkeitsansammlung im Gewebe meiner Seele. Ich halte das Buch in den Händen und denke: Kracht ist wie eine kühlende Seidendecke. Ich werde mich mit der Lektüre ins Bett legen, und mich in seine Sätze betten, mich von ihnen sanft wiegen lassen.
Kracht hat mich immer getröstet. Jedenfalls vor „Imperium“, bei jener Geschichte des deutschen Kokosnussverehrers, der sich auf nach Deutsch-Neuguinea machte, um eine Kokosnussplantage zu betreiben, bin ich ausgestiegen. Ich habe das Buch bei meinem Wegzug von Scuol in den Bücherschrank auf dem Motta Naluns gelegt. Ein würdiger Ort für einen ungelesenen Kracht. Ein Zürcher Hipster wird darin gelesen haben, während er an einem der langen Tische im Restaurant La Motta sass und einen Kafi Luz trank, auf seine Kiddies wartend, die gerade einen Skilehrer quälten. Wahrscheinlich waren es eher zwei Kafi Luz.
Jedenfalls fehlte mir bei „Imperium“ der Krachtsche Ton, Soundtrack meiner Zwanziger. In Berlin hatte ich mir “Faserland” aus einem Antiquariat in Kreuzberg 61 geholt, auf die dringende Empfehlung eines indischen Yogis hin, ich müsse mehr lesen (und zwar nicht nur Romane). Ich schleppte stapelweise Bücher nach Hause, trug meiner Schwester am Telefon meine neusten Erkenntnisse vor. Plötzlich war mir klar, warum mir die Sprachphilosophen auf den Wecker gingen. Sie hatten alles bis ins Kleinste zerlegt, und so die Sprache um ihre Substanz gebracht. Durch ihr gnadenloses Sezieren hatten sie den Boden bereitet für den unsäglichen Postmodernismus, der alles gleichsetze, Scheisse und Gold, der keine Geschichten mehr zuliess, nur noch Ereignisse, Koinzidenzen und Diskurse. Als Gegenmassnahme las ich Sloterdijk und kühlte mich bei Kracht ab.
Gleichzeitig verschmilzt in meiner Erinnerung an Berlin alles zu einem seltsamen Brei aus hedonistischer Sehnsucht und Verzweiflung, verrückten Gestalten auf breiten Strassen, in dunklen Clubs mit eindringlichen Beats, Ekstase des Jahrhunderts. Frühmorgens im Taxi um die Siegessäule, im Park bei sanftem Herbstlicht eine Liebesgeschichte in einer langen Umarmung ausklingen lassend, längst zu Musik geworden, irgendwo im Äther verewigt.
Genau dieses Lebensgefühl fing Kracht ein. Selbstentfremdung als ästhetisches Prinzip. Wie sonst sollte man dieser kaputten Welt entgegen treten, wenn nicht mit grösstmöglicher innerlicher Distanz, Luxusartikel, Drogen und Kurztrips als Schutzschild, damit ja nichts rankam an ein Herz, das in seiner Sehnsucht doch so rein war…
Während die Wirtschaftskrise dunkle Schatten über das grosse Partydorf warf, Schatten, von denen niemand so recht wusste, was sie zu bedeuten hatten, ausser, dass man sie am besten mit tanzen vertrieb, schrieb ich in wenigen Wochen einen Text mit dem Titel „Meer ohne Küste“, mit dem ich mich an einer Schweizer Schreibschule bewarb. Ich erinnere mich an jenen Schriftsteller, der mich beim Prüfungsgespräch anstarrte, als ob er einen Käfer vor sich gehabt hätte, ein Käfer, der behauptete, schreiben zu wollen. Wir schienen uns aus früheren Reinkarnationen längst zu kennen. Vielleicht fiel mir in diesem Moment auch wieder die Prüfung an der Schauspielschule ein, die Aufforderung des Schauspielprofessors, ich solle über ein Seil gehen, und denselben Text nochmals rezitieren. Damals war ich Jeanne d’Arc gewesen.
Nach dem Gespräch suchte ich die Toilette auf, um mich zu versichern, dass mein Panzer sass, als mein Blick auf das kleine Plakat an der Türe fiel. Man solle doch die Hände gründlich waschen und desinfizieren. Wegen der Schweinegrippe.
Sehr Vieles im Leben ist eine Erinnerung.
Unsere Lehrer ähneln sich, werden wir selber Lehrer, begegnen uns dieselben SchülerInnen; die verträumten Rebellen, die Antoine Doinels, die unglücklichen Lolitas, die Streberinnen, die auch keiner so recht will… Ich war alles in einem, unfähig erwachsen zu werden, weil das, was ich sah, nicht meine Welt war, und mir doch die Sprache und die Erfahrung, das Unbehagen zu benennen, fehlten. Der Schriftsteller fragte mich, was ich denn werden wolle, Bestsellerautorin oder Nobelpreisträgerin. Ich antwortete: „Beides.“
Heute weiss ich, dass man beides nicht wird, wenn man nicht an den richtigen Stellen schweigt. Am Schreiben aber kann einen niemand hindern. Und noch immer habe ich das Gefühl, noch gar nicht begonnen zu haben. (Wie schön Jürg Halters Hörbuchtitel aus dem Jahr 2007: „Aber heute ist der Tag, an dem ich mehr als sprechen will“)
In der Jugend will man alles, kann aber wenig. Später kann man viel, will aber nur noch Weniges, weil manche Pfeiler unverrückbar scheinen.
Christian Kracht ist in „Eurotrash“ seinem Unbehagen auf den Grund gegangen, und er rüttelt gewaltig an den Pfeilern.
In diesem autofiktionalen Roman arbeitet er die Nazivergangenheit seiner Familie auf, stellvertretend für manches gutbürgerliche Elternhaus im Nachkriegsdeutschland.
Der Vater ist Vorstandsvorsitzender bei Axel Springer, die Mutter schon früh alkohol- und tablettensüchtig. Regelmässig stellt sie sich vor der Waschmaschine tot. Alles ist mit allem auf unerklärliche unheilvolle Weise verbunden: Die Expressionisten im Château des Vaters in Morges, – „Morges, das hatte für mich immer wie ein Gemenge aus manger, Mord und morsch geklungen.“, die Wohnung im Londoner Stadtteil Mayfair, das Chalet in Gstaad, die Villa in Cap Ferrat, das Haus auf Sylt, die SM-Kammer des Grossvaters, die hinter einem Gobelin verborgenen SM-Utensilien des Patenonkels, der als Bindeglied zwischen Verlagshaus und einem Kriegsmalern der SS fungierte, das Verlagshaus, das sich bis zum heutigen Tag zu absoluter Israel-Treue verpflichtete, während die Mutter wiederum im Alter in die Milchwirtschaft und Waffen investiert…
Das Grauen ist abgrundtief. Kracht setzt der Tristesse einer einsamen Kindheit und Jugend exzentrische Einfälle eines leicht gestörten Rebellen entgegen. So behauptet der Ich-Erzähler Kracht, als Kind seine Schule in Gstaad angezündet zu haben.
„Die Häuser waren immer abgebrannt, und ich habe mich immer gefragt, was das zu bedeuten hatte, vielleicht wusste es meine Mutter, ich jedenfalls wusste es nicht.
Ich hatte mich als kleines Kind immer voller Angst vor ein Gemälde gestellt, das bei uns im Chalet hing, an der hölzernen Treppe nach oben. Irgend ein Holländer war es gewesen, im Hintergrund war ganz klein ein brennender Bauernhof in Flandern darauf zu sehen gewesen, an mehr konnte ich mich nicht erinnern, an Schnee vielleicht noch, an am weissbewölkten Winterhimmel kreisende Krähen wohl auch, an schwarzbekleidete Menschen, die von links kamen und ins Bild liefen. Heute habe ich das Gefühl, es sei Pieter Bruegels Die Jäger im Schnee gewesen, das dort bei uns an der Wand hing und das ich wiederum Jahrzehnte später einmal im Kunsthistorischen Museum in Wien gesehen hatte.
Das Feuer jedenfalls war immer in mir gewesen, der Hausbrand, die glühenden Überreste der Chalets, auch die von mir angezündete Grundschule Marie-José in Gstaad, die mir beim Jugendgericht in Thun als Siebenjähriger vorgelegten Polaroids, die beweisen sollten, was ich getan hatte.“
Die Passage beschreibt die Atmosphäre, in der jederzeit etwas in Flammen aufgehen kann. Das drohende Unheil hängt millionenschwer an den Wänden, verführerische Anleitung zur unausgesprochenen Tat. Dabei ist unwichtig, ob es dieses Gemälde im Chalet in Gstaad wirklich gegeben hat, und ob der kleine Christian tatsächlich seine Schule angezündet hatte oder der Brand einzig seiner Fantasie entsprang.
Immer wieder ist die Rede vom absurden Reichtum des Vaters, der selbst der Hamburger Unterschicht entstammte:
„Unsere Beziehung zueinander bestand aus einer einzigen Affirmation seines feudalistischen Wesens. Es war nicht möglich gewesen, anderer Meinung zu sein, zu keiner Zeit war dies möglich gewesen, man arrangierte sich, stimmte ihm zu und erhielt dafür Geld.“
Diese Passivität des Sohnes unterstreicht der Autor Kracht mit einer Aussage der Mutter, die auf dem gemeinsamen Road Trip ins Berner Oberland ihren Sohn daran erinnert, wie dieser als Kind behauptete, unter der Glaskrankheit zu leiden.
Die Autofiktion, der Begriff geht auf den Schriftsteller und Kritiker Serge Doubrovsky zurück, erzeugt immer einen bestimmten Resonanzraum, indem der Autor zwar von sich und seinem Umfeld ausgeht, Gegebenheiten und Personen aber nach Belieben verfremdet.
Der Roman lebt von den grotesken Unterhaltungen zwischen Mutter und Sohn auf der letzten gemeinsamen Reise, auf der sie das schmutzige Geld auf den Putz hauen wollen.
Der Ich-Erzähler beschreibt die Mutter, welche diverse Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken hinter sich hatte als böse und manipulativ. Auch wenn er um ihre schwere Geschichte weiss, gelingt es ihm erst Mitgefühl aufzubringen, als sie eine Schwäche offenbart. Sie, die ihr Leben im Luxus verbracht hatte, getraut sich auf einmal nicht mehr in ein Restaurant.
Ihr Verstand ist messerscharf, auch verfügt über das zweite Gesicht. Momente der Zärtlichkeit stellen sich ein, wenn die Mutter gebannt den Geschichten des Sohnes lauscht.
Da ist beispielsweise die Geschichte der Gebrüder Schlumpf, welche in Basel eine Textilfabrik mit tausenden Angestellten geführt, und die eine heimliche Leidenschaft für Luxuskarossen gepflegt hätten. Der Autor von Faserland, als welcher sich der Ich-Erzähler gebiert, erzählt weiter, dass die Gebrüder Schlumpf dreihundert dieser teuren Automobile in einem Hangar versteckt gehabt hätten, als sie ihre Arbeiter nicht mehr haben bezahlen können. Daraufhin seien diese in Streik getreten. Als einer von ihnen den Hangar entdeckt habe, hätten die Arbeiter in ihrer Wut alles kurz und klein geschlagen. Der Ich-Erzähler fährt fort:
„…und die Gebrüder Schlumpf, die über den Verlust ihrer Sammlung todtraurig waren, mieteten sich im Hotel Trois Rois in Basel ein, in einer grossen Suite, und sie liessen einen Maître Chocolatier kommen, den besten der Schweiz, und trugen ihm auf, er möge alle ihre von den Arbeitern zerstörten Automobile nachbauen, aus Schokolade, ganz klein, also Spielzeugautos aus Schokolade. Die ganze Sammlung noch mal. Und als er fertig war, liessen sie ihn kommen mit den Modellen, und sie bauten sie in ihrer Suite im Hotel auf, liessen die Suite klimatisch abkühlen auf wenige Grad über Null und schlossen die Türe von aussen ab.“
Die vordergründige Niedlichkeit solcher pointierter Geschichten kontrastiert Kracht mit bitterbösen Schimpftiraden, wenn er zu Beginn des Romans den Protagonisten durch Zürichs Einkaufsstrassen flanieren lässt:
„… Aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen, dort, wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Ein Deutschland, dessen männliche Einwohner immer in ihre männlichen Mobiltelefone hineinschrien in der Öffentlichkeit, besonders wenn sie in der Schweiz waren, und wo es so klang und aussah, als telefonierten sie mit der Reichspropagandaleitung, breitbeinig hingefläzt in den Sesseln der Senator-Lounge, während sie in Wirklichkeit nur mit einer Werbeagentur telefonierten oder mit ihrem Ressortleiter. Ein Glück, dachte ich, ein Glück, ein Glück war ich in der Schweiz.“
Tja, wer möchte mit diesem Autor nicht auch gerne um die Häuser ziehen, um in einem verzweifelten Lachen den schlimmsten Abgrund zu überwinden? Wer vermisst nicht auch jene Menschen, die reinsten Herzens mit ihrem Atem die Blätter vor dem Mund abfackeln, um einfach zu sprechen, und die in ihrer Verzweiflung all das Unaussprechliche benennen, als würden sie dadurch die ersten Schritte in einer neuen Welt gehen…
„Was bezweckst Du denn damit? Weitere Katharsisse? Sagt man das so? Wie ist eigentlich der Plural von Katharsis? Katharsen?“, fragt die Mutter, auf die Bitte des Sohnes hin, in Morges Halt zu machen, um ein letztes Mal das Chateau des Vaters zu besuchen.
„Ich weiss es nicht. Die Katharsis hat keinen Plural.“, antwortet daraufhin der Sohn.
Wenn die Katharsis schon keinen Plural hat, dann wünscht man sich einfach mehr davon.
Mehr Kracht.
Mehr Welt.
Meine kleine Depression hat einer sanften Stille Platz gemacht. Passend zum ersten Schnee, dessen Decke sich zentimeterdick über die sommermüden Glieder legt.