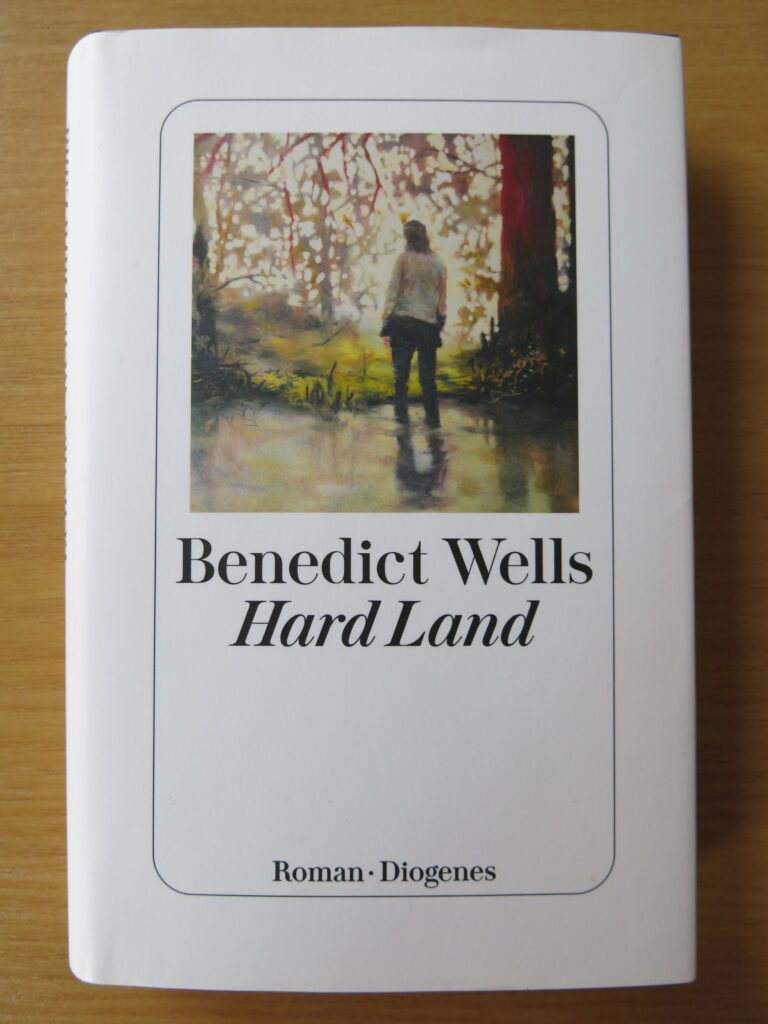Ein literarischer Essay inspiriert von Benedict Wells’ “Hard Land”
Mein Chilibaum ist von Blattläusen befallen. Hoffentlich hilft ihm die neue Erde, die unliebsamen Gäste loszuwerden.
Auch ich habe mich „umgetopft“, und mich laust etwas. Meine Haut ziept wie damals in meiner Pubertät, als mir ein Hautausschlag um den Mund das Leben schwer machte. Ich sprach nicht viel, und durch den Ausschlag verstummte ich fast vollständig, schliesslich wollte ich nicht unnötig die Aufmerksamkeit auf mich lenken.
Abends lese ich Benedict Wells‘ „Hard Land“, eine Adoleszenz-Geschichte, welche meine verschütteten Erinnerungen wieder hervorholt. Meine Zellen scheinen nicht vergessen zu haben, dass mir damals etwas unter die Haut ging. Überflüssig zu sagen, dass ich mich unwohl in meiner Haut fühlte. In diesen Tagen reagiert sie wieder mit Rötungen und sagt: „Hörst du mir vielleicht jetzt mal zu?“
Ich höre Bruce Springsteen, der auch bei Wells eine Rolle spielt. Auf der Ladefläche des sogenannten Bruce Mobils – im Wagen darf nur Bruce Springsteen gehört werden – surfen die Protagonisten über Erdwälle, bis sie das Gleichgewicht verlieren. Auch ich liebte damals Geschwindigkeit und Höhe.
Die letzten Tage begleitete mich „Streets of Philadelphia“. Meine erste Filmrezension schrieb ich in der neunten Klasse über „Philadelphia“, indem Tom Hanks einen Aids-Kranken spielt, der im Sterben liegt.
Der verstockte Protagonist in „Hard Land“ findet im Kino einen Sommerjob, die letzte Ausflucht, um nicht den Sommer bei seinen unliebsamen Cousins verbringen zu müssen. Hier trifft er auf Cameron, Hightower und Kirstie, die ihn seine Schüchternheit überwinden lassen. Sie diskutieren über Filme, Sam erlebt seinen ersten Alkoholrausch und ist unsterblich verliebt.
In Biel begann ich mit Mitte zwanzig für fast fünf Jahre im schönsten Kino der Stadt zu arbeiten. Zwischen Pop Corn machen, Tickets und Eis verkaufen, konnte ich lesen und schreiben und mit meinen PlatzanweiserInnen scherzen. Der Operateur, der am Wochenende arbeitete, legte mir jeweils stillschweigend seinen aktuellen Buchtipp auf den Tresen. Auf seine Tipps war hundertprozentig Verlass. An freien Tagen liess ich mich nach einem ausgiebigen Spaziergang um 18.00 Uhr in einen Kinosessel fallen, um mir einen Arthouse-Filme anzuschauen. Ganz selten zog ich mir auch einen Blockbuster rein, aber spätestens danach ging’s mir dann wirklich schlecht.
Irgendwann hatte ich – wie im Film – eine Knarre am Kopf, und wurde von einem Vermummten aufgefordert, das Bargeld rauszurücken. Später sass ich vor einem Kommissar, der seine blonden langen Haare zu einem Bun gebunden hatte, um Tathergang, Körpergrösse, Gangart und Dialekt des Räubers zu beschreiben.
Das war ein Jahr nach dem Bataclan-Massaker, und ich dachte: Das darf doch jetzt nicht wahr sein, auf diese blöde Art sterben zu müssen. So völlig abrupt. Es war, wie dieser Text beweist, zum Glück doch noch nicht der Moment sich zu verabschieden. Aber seither ist mir bewusst, dass niemals der richtige Moment kommen wird, dass man dem Tod wohl immer verblüfft ins Gesicht schaut, als ob es ein Irrtum oder ein Scherz wäre, dass man nun tatsächlich an der Reihe ist.
Als ich vierzehn war, kam ein Junge, der ein Jahr über uns, in der neunten Klasse, war, bei einem Fahrradunfall ums Leben. Er hiess Sam. Nach einer Bandprobe stürzte er mit dem Rad in einer Kurve. Sie war steil. Aber er war diese Strecke mit seinen Freunden jeden Tag gefahren. Ich erinnere mich an dieses lange Schweigen, das Tage, Wochen und Monate anhielt. Noch heute sehe ich ihn vor mir, wie er sich vor dem Volleyballnetz eine Haarsträhne aus dem Gesicht pustet. Er hatte halblanges schwarzes Haar, blasse Haut und seine Bewegungen waren sehr geschmeidig. Ich weiss nicht, ob ich erst später dachte, dass ihm etwas Unwirkliches anhaftete oder er mir gerade deshalb so gefiel. Jedenfalls schien er über eine besondere Sensibilität zu verfügen, die ihn von den anderen abhob, ohne dass er deswegen sonderbar oder überheblich gewirkt hätte.
Wir sangen Sam zu Ehren Bach im Chorunterrichcht, jedenfalls denke ich heute, es muss Bach gewesen sein, vielleicht „Gottes Zeit“, und ich dachte damals: Warum nicht Eric Clapton, er hat doch Eric Clapton geliebt.
Es ist unsinnig, darüber zu spekulieren, was jemand, der früh stirbt, noch alles hätte werden können. Aber Sam wäre mit Sicherheit Berufsmusiker geworden. Und ja, auch Bach hätte er sicherlich geliebt.
In „Hard Land“ stirbt Sams Mutter an seinem sechzehnten Geburtstag an einem Gehirntumor. An der Beerdigung greift er in die Seiten seiner E-Gitarre, das Geschenk seiner Eltern, das er erst verschmähte, begleitet von seiner Schwester an der Orgel, um „Dancing with Myself“ von Billy Idol in der Kirche hinzuschmettern.
Mit dem Lieblingssong der Mutter retten die beiden den Gottesdienst unter der Leitung von Reverend Connors, dem einzig der Vater etwas abgewinnen kann. Sam überwindet mit diesem Auftritt seine Schüchternheit und die Schuldgefühle, seine Eltern an seinem Geburtstag zugunsten seiner Freunde versetzt zu haben.
Ich weiss nicht, wann ich meine Schüchternheit überwunden habe oder gar erwachsen geworden bin. Zwar habe ich gelernt, zu kommunizieren, Small Talk zu führen, mich in Gemeinschaften zu engagieren und kleinere und grössere Gefechte auszutragen. Aber ich fühle mich in grösseren Gesellschaften immer noch unwohl.
Gunnar Kaiser antwortete kürzlich auf die Frage, warum er Philosoph geworden sei, er hätte sich im Alter von fünfzehn, sechszehn Jahren immer anders gefühlt als die anderen, und nur die Schriftsteller und Philosophen hätten ihm befriedigende Antworten liefern können.
Ich fand erst mit siebzehn bei Dostojewski eine geistige Heimat. Und jetzt, in diesen Tagen, habe ich stärker denn je das Gefühl, nicht in diese Welt zu passen.
In ihrem letzten High School Jahr diskutieren die Schüler in “Hard Land” ein Epos des berühmtesten Bewohners der Stadt, William Morris. „Kindsein ist wie einen Ball hochwerfen, Erwachsenwerden ist, wenn er wieder herunterfällt.“, heisst es da.
Mir scheint, als ob im Moment ganz viele Bälle vom Himmel fallen. Aber lange nicht alle sind bereit, den Ball aufzufangen, und ihre kindlichen Vorstellungen von der Welt aufzugeben.
Im Epos heisst es an anderer Stelle. „Entschlossen steige ich in das Boot. Kein Zoll mehr in mir, der sich fürchtet. Denn ich weiss die Stadt in meinem Rücken und bin nicht allein. Und so rege ich die Ruder, stets zum Neuen vor und zurück… Bis hinaus über die Zeit, denn zurückkehren kann ich nur als Mann.“
Die frivole Kirstie ist die einzige im Roman, welche dem Dichter auf die Schliche kommt, und die Stelle als Verlust der sexuellen Unschuld interpretiert.
Erwachsenwerden bedeutet also, neues Leben zeugen, gebären und nähren zu können.
Wenn ich mich umschaue, sehe ich zwar Kinder, aber wenig Ideen und Initiativen, sie vor einer Welt zu schützen, die nur auf Profit und Gehorsam aus ist, die Daten sammelt aber keine Gedanken und Geschichten, die danach strebt, den Menschen selbst abzuschaffen, seine Lust, seinen Schmerz, seine Sterblichkeit.
Wenn ich sehe, wie breitwillig Menschen ihre körperliche Unversehrtheit aufgeben, und sich freiwillig für die grösste medizinische Studie in der Geschichte der Menschheit zur Verfügung stellen, bloss um ein paar Tage im Ausland Urlaub zu verbringen, dann bekomm ich wieder diesen Ausschlag. Die Ärztin meinte, es könnte Zöliakie sein.
Allergisch auf das tägliche Brot und den Broterwerb.
Wie heisst es bereits 1590 in Michael Neanders Sammlung der deutschen Sprichwörter: „Kunst gehet nach Brot“.
Tief in der Seele ist der Künstler jemand, der den Ball immer wieder in die Luft schmeisst, auch wenn das Auffangen des Balles manchmal über seine Kräfte hinausgeht.
Fragt also den Künstler nicht mehr: „Kannst du von deiner Kunst leben?“
Fragt ihn stattdessen: „Wie kannst du trotzdem leben?“
Mittlerweile ernähren sich übrigens kleine Fliegen von den Blattläusen.